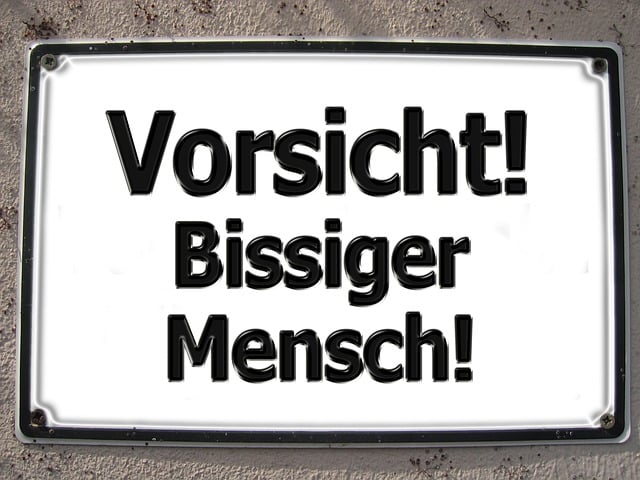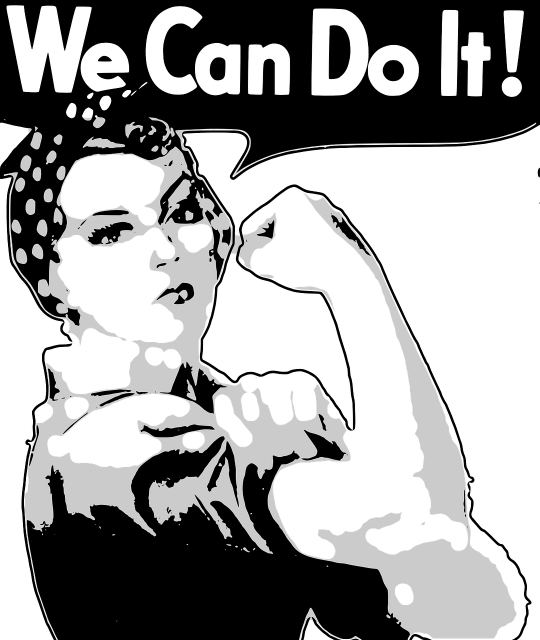Boomer erinnern sich vielleicht an etwas Besonderes am Heiligabend ihrer Kindheit: Nachmittags hockten wir vor dem Fernseher und guckten Warten aufs Christkind. Kater Mikesch, Hase Cäsar und andere Legenden unseres damaligen Medienkonsums halfen mit lustigen Geschichten bei einer der unangenehmsten Situationen des menschlichen Daseins, dem Warten.
Mit Warten ist hier nicht das Abwarten gemeint, zum Beispiel wenn man auf das Abkühlen des frisch gebrühten Tees wartet, damit er endlich trinkbar wird. Zu unterscheiden ist auch die Pause, mit der man eine Tätigkeit aus eigenem Antrieb unterbricht, bis man Lust oder Kraft hat weiterzumachen.

Es geht um Warten, das nervt und stresst. Dieses Warten ist unfreiwillig und wird dem Wartenden aufgezwungen: in der Telefon-Hotline, an der Haltestelle, am Bahngleis, in der Arztpraxis, auf dem Bürgeramt, in der Warteschlange vor Kassen, Schaltern etc. Ist es nur der Zeitdruck in der modernen Welt, oder warum empfinden wir Warten so sehr als Zumutung?
Weil der, der uns warten lässt, über unsere Zeit gebietet. Es entsteht also eine Hierarchie zwischen dem Wartenden und dem Warten-Lassenden. Hier wird gnadenlos Macht ausgeübt. Wie soll man sich da locker machen?
Warte, warte nur ein Weilchen …
Am anschaulichsten wird die soziale Natur des Wartens bei Hierarchie-Hickhack, wo es auch vordergründig um Macht und Status geht.
„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige“, weil Letztere sie gesellschaftlich nicht nötig haben.
Umgekehrt scheinen manche Mächtige Machtspielchen mittels Warten nötig zu haben. So hat 2022 der französische Präsident Macron den auf die Minute pünktlichen deutschen Bundeskanzler fünf Minuten vor dem Elysée-Palast warten lassen. Man hatte sich vorher über die deutsche Regierung geärgert. Das war aber noch charmant. Es gibt eine Liste, wen der derzeitige russische Präsident wie lange warten ließ: Angela Merkel über vier Stunden, den Papst eine Stunde und die Queen vierzehn Minuten.
Ein historischer Vorgänger des politischen Warten-Lassens ist Papst Gregor VII., der den exkommunizierten König Heinrich IV. drei Tage vor der Burg Canossa warten ließ, bevor er ihn einließ und ihm Absolution erteilte. Der „Gang nach Canossa“ aus dem 11. Jahrhundert dient bis heute als Bild für das unfreiwillige Abbitte leisten.
In einer Sendung über royales Protokoll war neulich zu erfahren, wie es bei Hochzeiten mit königlichen Gästen bei der Toilettenpause zugeht. Selbstverständlich zelebriert man die ultimative Organisationsform des zivilisierten egalitären Wartens: die Schlange. Doch ließ uns eine Dame der Hocharistokratie wissen: Wenn eine Königin muss, müssen alle anderen erst mal nicht müssen.
Fürs Leben im Alltag gibt es kein klares Protokoll. Der Wartestress ist allgegenwärtig. Früher ließ uns der Türsteher vor dem Disco-Eingang schmoren, heute hocken wir in der Praxis. Die Ärztin lässt sicher nicht aus Bosheit warten, und dennoch kommt der lukrativere Privatpatient früher dran. Die Bahn versucht immerhin, die Demütigung ihrer wartenden Kunden durch Zwischeninformationen zu lindern.
Sorry, aber …
Im Warten steckt also ein ganzer Kosmos an gestörter Harmonie. Instinktiv begreift jeder, dass man den Hierarchiezustand der Übergeordnetheit des Warten-Lassenden und der Untergeordnetheit des Wartenden ausgleichen sollte. Dafür gibt es die Entschuldigung und die Ausrede, wobei beide eng miteinander verknüpft sein können. Die Ausrede kann richtig gut gelogen oder auch faul sein. Allerdings kann der, der warten musste, mit etwas Großmut schon den schlichten Versuch einer Entschuldigung anerkennen. Wie der Wartende den Grund oder die Absicht hinter dem Warten-Lassen beurteilt, ist äußerst bedeutsam für das persönliche Stress-Empfinden.
Das hat seine Grenzen. Zum Beispiel bei der „Entschuldigung“ meiner Bekannten, die mich 20 Minuten am Parkeingang hat warten lassen: „Ach, du weißt doch, dass ich immer ein bisschen unpünktlich bin“. In klassischer Täter-Opfer-Umkehr sollte ich mich ihrer Meinung nach in der Einschätzung ihrer Persönlichkeitsmerkmale geirrt haben. Auf weitere Kostproben habe ich gerne verzichtet.
Man kann sich in der Zeit verschätzen, aber dem überpünktlichen Menschen, der lieber das Risiko eingeht, selbst warten zu müssen, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt, spreche ich genuine Noblesse zu.
Worauf wartet ihr noch?
Um Macht geht es bekanntlich auch zwischen den Geschlechtern. Ein Parole könnte sein: „Frauen, worauf wartet ihr noch?“ Zumal historisch das Warten weiblich und das Warten-Lassen männlich interpretiert sind. Nach dieser Lesart verlässt er, der Jäger und Sammler und später der Mann mit moderneren Berufen, das Heim, die dazu gehörige Frau wartet auf seine Rückkehr.
Die Urmutter des weiblichen Wartens finden wir in der griechischen Mythologie, wo Penelope zwanzig Jahre auf ihren Gatten Odysseus wartet. Das heißt nicht, dass die Wartende untätig ist. Schließlich erwehrte sich die treue Penelope der zahlreichen Freier, indem sie vorgab, erst ein Totentuch fertig weben zu müssen (das sie Nacht für Nacht wieder aufknüpfte). In der patriarchalen Gesellschaftsstruktur hat die häusliche Frau (je nach Einkommensstand) ebenfalls genug zu tun. Doch über die Zeitstruktur des Lebens bestimmt sie nicht, sie wartet.
Andere Länder, anderes Warten
Weltläufige Menschen argumentieren gerne, Warten sei nur eine Frage der Bewertung. Es gäbe schließlich andere Kulturen, in denen der Bus nicht pünktlich abfährt, sondern wenn nach Meinung des Fahrers genügend Plätze besetzt sind. Alle warten und haben (angeblich) kein Problem. Oder man lässt die Verabredung warten, weil man auf dem Weg dorthin einen Freund getroffen hat, den man unmöglich kurz abfertigen konnte. Der soziale Frieden kann ungestört bleiben, da es alle so machen, es also die Regel ist. Klar, verstehen wir, funktioniert aber nicht bei uns. Vielleicht sind wir weniger entspannt oder wir sind es schlicht nicht gewöhnt und willens, Fremdbestimmung zu akzeptieren.

Die Sozialisierung in der hiesigen Lebensorganisation garantiert den mehr oder minder großen Stress, wenn wir warten müssen. Freilich gibt es eine Alternative, dem Warten-Müssen die Macht zu nehmen: Im Sinne der persönlichen Freiheit lasse ich sausen, worauf ich warten muss; ich steige aus. Wohl dem, der es sich leisten kann, es ein wenig nach Anarchismus riechen zu lassen. Dieses Heft des Handelns kann man selten in die Hand nehmen.
Meist ist das zu Erwartende so wichtig oder erstrebenswert, dass wir nicht nicht warten können. Wir sind dem Wartezwang hilflos ausgeliefert. Sind wir das?
Womit wir wieder zum Warten aufs Christkind kommen. Warten ist unangenehm, aber ich kann es angenehm gestalten. Das heißt nämlich: über die fremdbestimmte Zeitspanne etwas Kontrolle zurückgewinnen, Zeit nicht tot zu schlagen, sondern in lebendige Zeit zu verwandeln, von Passivität zur Aktivität, vom „Opfer“ zum „Täter“, von der Sinnlosigkeit zum Sinnvollen gelangen.
Ob es vor der Bescherung nun die Fernsehgeschichten oder Bastel- und Spiele-Nachmittage waren, wir können aus der Kindheit lernen: Warten, die nervige alltägliche Situation, kann durchaus erträglich sein, wenn man etwas daraus macht. Wer Wartezeit mit eigener Tätigkeit füllt, „beherrscht“ buchstäblich die Kunst des Wartens. Der wahre Wartekünstler kann erreichen, dass er das Ende der Wartezeit nicht mehr herbeisehnt.
Das Geheimnis ist, auf Wartesituationen vorbereitet zu sein. Buch, Zeitschrift und Strickzeug waren gestern. Heute drängt sich als mobiles Beschäftigungswerkzeug das Smartphone auf, da man es auch bei spontan entstehenden Wartezeiten immer dabei hat. Wenn man sich im öffentlichen Raum umschaut, scheint fast keiner mehr zu warten. Doch Vorsicht beim Social-Media-Chat. Wird meine Nachricht als gelesen angezeigt, aber nicht beantwortet, warte ich sozusagen beim Warten.
Warten mit Hirnschimmel
Also lieber jemanden anrufen, ein Online-Buch lesen. Ich kann sozusagen Zwischenziele verfolgen, die mich zum Hauptziel „Ende der Wartezeit“ tragen. Nicht gemeint ist das ziellose Herumwischen auf TikTok etc.. Dabei erreicht man keine produktiv zufriedenstellenden Zwischenziele wie Kontaktaustausch, Lesevergnügen oder Informationsgewinn, sondern Mini-Glücksmomente im Gehirn, die den Neurologen Sorgen bereiten. Im englischen Sprachraum wissen die Wisch-Süchtigen bereits, wie sie ihr Tun benennen müssen: „I was brain-rotting again“ (etwa: „Ich habe mal wieder mein Hirn vergammeln lassen.“) Auch nicht empfehlenswert: Wartezeit mit Doomscrolling überbrücken.
Womit wir beim besten Werkzeug für gekonntes Warten sind. Auch das Gehirn hat man schließlich immer dabei (sollte man zumindest). Die höheren Künste, die fremdbestimmte Wartezeit zurückzuerobern, finden wir in uns selbst: Denken, Meditation, Achtsamkeit, bewusste Langeweile.
Nichtstun durch Denken funktioniert am besten, wenn man Warten nicht als lästig, sondern eher als erquickliche Pause empfindet. Wenn es ein Spruch sein darf: Warten Sie noch oder leben Sie schon? Manche Menschen fühlen sich durch Warten sogar angenehm entschleunigt.
Denken heißt freilich nicht Grübeln, sondern Reflektieren. Man kann üben, den Switch von Wartezeit auf wohltuendes In-sich-Gehen so zu automatisieren, dass Ärger übers Warten gar nicht erst aufkommt. Das gilt besonders auch fürs Warten auf den Schlaf, das uns der Körper manchmal aufzwingt.
Wie Sie hören, hören Sie nichts
Der amerikanische Komponist John Cage hat ein Stück namens 4’33“ komponiert. Zu hören ist vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden lang nichts beziehungsweise das „Konzert“ der jeweiligen Umgebungsgeräusche, wo auch immer der Zuhörer das Stück rezipiert. Hier darf freiwillig und aktiv gedacht werden. Eine Zumutung? Eine fantastische Wartezeitbeherrschungsübung!
Warten wie auf der Wartburg
Eine besondere Herausforderung sind jedoch längere Wartezeiten, etwa das Warten auf eine Diagnose, auf Prüfungsergebnisse oder das Ende einer Pandemie. Was machte Martin Luther, als er auf der Wartburg darauf wartete, dass er ohne Lebensgefahr in sein reformatorisches Leben zurück kann? Er kam auf die Idee, die Bibel zu übersetzen und mal eben die Grundlagen für unser heutiges Deutsch zu schaffen.
Umwidmung der Wartezeit in etwas Positives gelingt durch Warten-Können. Der Nutzen erschließt sich nicht unmittelbar, aber Kreative wissen, dass der Einfall nicht erzwungen werden kann, sondern meist aus der Leere kommt. Wenn man Warten mit Nichtstun füllt, kann Großes entstehen.
Freilich bleibt Warten immer noch Warten, denn die Zeit kann zwar persönlich gefüllt, aber nicht eigenständig beendet werden. Zu allen Methoden, Warten vom Stress zu Wohlbefinden zu verwandeln, gehört eine Prise von dem, was sich Cool Ager ohnehin vorgenommen haben: Gelassenheit.
English version
Waiting
Boomers may remember something special about Christmas Eve during their childhood: in the afternoon, we would sit in front of the TV and watch Warten aufs Christkind (Waiting for Santa Claus). Mikesch the cat, Caesar the rabbit, and other legends of our media consumption at the time helped us get through one of the most unpleasant situations in human existence, waiting, with funny stories.
Waiting here does not mean waiting around, for example, waiting for freshly brewed tea to cool down so that it is finally drinkable. It is also different from taking a break, where you interrupt an activity of your own accord until you feel like or have the energy to continue.
It’s about waiting, which is annoying and stressful. This waiting is involuntary and imposed on those who wait: on the telephone hotline, at the bus stop, on the train platform, at the doctor’s office, at the government office, in the queue at the cash register, at the counter, etc. Is it just the time pressure in the modern world, or why do we find waiting so unreasonable?
Because the person who makes us wait has control over our time. This creates a hierarchy between the person waiting and the person making them wait. Power is exercised mercilessly here. How can you relax in a situation like that?
Wait, just wait a little while…
The social nature of waiting is most evident in hierarchical squabbling, where power and status are also ostensibly at stake.
“Punctuality is the politeness of kings,” because the latter do not need it socially.
Conversely, some powerful figures seem to feel the need to play power games by keeping others waiting. In 2022, French President Macron kept the German Chancellor, who is known for his punctuality, waiting for five minutes outside the Élysée Palace. The German government had annoyed him beforehand. But that was still charming. There is a list of who the current Russian president has kept waiting and for how long: Angela Merkel for over four hours, the Pope for an hour, and the Queen for fourteen minutes.
A historical predecessor of political waiting is Pope Gregory VII, who made the excommunicated King Henry IV wait three days in front of Canossa Castle before admitting him and granting him absolution. The “Walk to Canossa” from the 11th century is still used today as an image for involuntary apology.
A recent TV program on royal protocol revealed what happens during toilet breaks at weddings with royal guests. Naturally, the ultimate form of civilized egalitarian waiting is celebrated: the queue. However, a lady of the high aristocracy informed us that when a queen needs to go, everyone else has to wait.
There is no clear protocol for everyday life. The stress of waiting is omnipresent. In the past, bouncers made us sweat in front of the disco entrance; today, we sit in doctors‘ offices. The doctor certainly doesn’t make us wait out of malice, and yet the more lucrative patient with private insurance gets seen first. At least the railway company tries to alleviate the humiliation of its waiting customers by providing interim information.
Sorry, but…
Waiting therefore contains a whole universe of disturbed harmony. Everyone instinctively understands that the hierarchical relationship between the superiority of the person who makes others wait and the inferiority of the person who waits should be balanced. This is where apologies and excuses come in, both of which can be closely linked. Excuses can be well-crafted lies or simply lazy. However, those who have been kept waiting can, with a little generosity, acknowledge even a simple attempt at an apology. How those who are kept waiting judge the reason or intention behind the delay is extremely important for their personal perception of stress.
This has its limits. Take, for example, the “apology” from my acquaintance who kept me waiting at the park entrance for 20 minutes: “Oh, you know I’m always a little late.” In a classic way of victim blaming, she suggested I had misjudged her personality traits. I gladly declined further samples.
It’s easy to misjudge the time, but I attribute genuine nobility to the overly punctual person who prefers to take the risk of having to wait themselves without losing face.
What are you waiting for?
It is well known that power is also an issue between the sexes. A slogan could be: “Women, what are you waiting for?” Especially since, historically, waiting has been interpreted as feminine and letting things wait as masculine. According to this interpretation, the hunter-gatherer, and later the man with more modern professions, leaves home, and the woman associated with him waits for his return.
We find the archetype of female waiting in Greek mythology, where Penelope waits twenty years for her husband Odysseus. This does not mean that the woman waiting is inactive. After all, the faithful Penelope fended off her numerous suitors by pretending that she first had to finish weaving a shroud (which she unraveled night after night).
In the patriarchal social structure, the housewife also has enough to do (depending on her income). But she does not determine the time structure of her life; she waits.
Other countries, other ways of waiting
Cosmopolitan people like to argue that waiting is only a matter of perspective. After all, there are other cultures where buses do not leave on time, but only when the driver thinks there are enough passengers. Everyone waits and (supposedly) has no problem with it. Or you keep someone waiting for an appointment because you met a friend on the way and couldn’t possibly say goodbye quickly. Social harmony remains undisturbed because everyone does it, so it’s the norm.
Sure, we understand, but it doesn’t work for us. Maybe we are less relaxed, or maybe we are simply not used to it and unwilling to accept being controlled by others.
How to make waiting more pleasant
Socialization in our local way of life guarantees a greater or lesser amount of stress when we have to wait. Of course, there is an alternative that takes away the power of having to wait: in the spirit of personal freedom, I let go of what I have to wait for; I opt out. Lucky are those who can afford to let a little anarchism into their lives. However, it is rare to be able to take this course of action.
Most of the time, what we are waiting for is so important or desirable that we cannot not wait. We are helplessly at the mercy of the compulsion to wait. Are we?
Which brings us back to waiting for Santa Claus. Waiting is unpleasant, but I can make it pleasant. That means regaining some control over the time that is determined by others, not killing time, but transforming it into living time, moving from passivity to activity, from “victim” to “perpetrator,” from meaninglessness to meaning.
Whether it was watching TV, doing crafts, or playing games before Christmas, we can learn from our childhood: waiting, that annoying everyday situation, can be quite bearable if you make something of it. Those who fill waiting time with their own activities literally “master” the art of waiting. The true master of waiting can achieve a state where they no longer long for the end of the waiting period.
The secret is to be prepared for waiting situations. Books, magazines, and knitting kits are a thing of the past. Today, smartphones are the mobile entertainment tool of choice, as they are always with us, even when we have to wait unexpectedly. If you look around in public spaces, it seems that almost no one is waiting anymore. But be careful with social media chat. If my message is marked as read but not answered, I am, so to speak, waiting while waiting.
Waiting with brain mold
So it’s better to call someone or read an online book. I can pursue intermediate goals, so to speak, that carry me to the main goal of “end of waiting time.” This does not mean aimlessly swiping around on TikTok, etc. This does not achieve any productively satisfying intermediate goals such as exchanging contacts, reading pleasure or gaining information, but rather mini moments of happiness in the brain that cause concern for neurologists. In English-speaking countries, swipe addicts already know what to call their behavior: “I was brain-rotting again.” Also not recommended: passing the time with doomscrolling.
Waiting skillfully
Which brings us to the best tool for waiting skillfully. After all, you always have your brain with you (at least you should). The higher arts of reclaiming waiting time that has been determined by others can be found within ourselves: thinking, meditation, mindfulness, conscious boredom.
Doing nothing by thinking works best when you don’t see waiting as annoying, but rather as a refreshing break. If you want a motto: Are you still waiting or are you already living? Some people even find waiting pleasantly relaxing.
Thinking does not mean brooding, but reflecting. You can practice switching from waiting to pleasant introspection so automatically that you don’t even get annoyed about waiting. This is especially true for waiting to fall asleep, which our body sometimes forces us to do.
As you can hear, you hear nothing
American composer John Cage composed a piece called 4’33“. For four minutes and thirty-three seconds, nothing can be heard except the ”concert“ of ambient sounds wherever the listener is listening to the piece. Here, you are free to think actively and voluntarily. An imposition? A fantastic exercise in mastering waiting time!
Waiting like at Wartburg Castle
However, longer waiting times, such as waiting for a diagnosis, exam results, or the end of a pandemic, are a particular challenge. What did Martin Luther do when he was waiting at Wartburg Castle to return to his reformatory life without fear for his life? He came up with the idea of translating the Bible and, in doing so, laid the foundations for the German language used today.
Waiting can be turned into something positive by learning to wait. The benefits are not immediately apparent, but creative people know that inspiration cannot be forced; it usually comes from a place of emptiness. If you fill waiting time with doing nothing, great things can happen.
Of course, waiting is still waiting, because although you can fill the time personally, you cannot end it yourself. All methods of transforming waiting from stress to well-being include a pinch of what cool agers have already decided to do anyway: serenity.