Hört das denn nie auf? Der aktuelle Krieg in Europa bringt uns Schrecken nahe, von denen wir uns längst entfernt glaubten. Aber war das Leid der großen Kriege des vergangenen Jahrhunderts in unseren Familien wirklich so weit weg? War es nicht. Denn die Nachkriegsgenerationen, die mit dem Leben in Frieden und Wohlstand, sind auch Kriegsenkel, also die Kinder von Kriegskindern. Und das kann so einiges erklären.
Viele Menschen der Generationen Boomer und X sind bisher mit Problemen durchs Dasein gegangen, die sie oft für ihr individuelles Schicksal halten: diffuse Ängste, psychosomatische Störungen, sogar Depression. Gleichzeitig ergaben Befragungen typische Antworten in Bezug auf ihre Eltern. Emotionale Fremdheit, wenig Körperkontakt, ausgeprägte Risikoscheu, Sparsamkeit und Leistungsorientierung waren Verhaltensweisen, mit denen der Nachwuchs konfrontiert wurde.

Millionen dieser Eltern hatten im zweiten Weltkrieg als Kind oder Jugendliche(r) Schrecken, Leid und Traumata erfahren: Verschickung ins Ausland, Flucht aus dem Osten, Vergewaltigung durch einmarschierende Soldaten, Todesangst in Bombennächten, Verlust eines oder beider Elternteile. Einige waren vom Leid ihrer Eltern an der Front oder in Lagern, andere von der Verstrickung ihrer Eltern in den Nationalsozialismus betroffen.
Von Generation zu Generation
Wir, die wir das nicht selbst erlebten, vermögen es uns kaum vorzustellen. Wie geht ein (junger) Mensch damit um? Wie sich herausstellte, wurden die grausamen Erfahrungen nach dem Krieg seelisch verdrängt und verkapselt. Doch wie wir heute wissen, ist die Nichtaufarbeitung nicht gesund und kann sich fatalerweise fortsetzen. Der Altersforscher Hartmut Radebold hat dafür folgenden Begriff geprägt:
transgenerationale Weitergabe.
Meist unbewusst wurden seelische Belastungen durch die Kriegserfahrungen an die Folgegeneration übertragen. Das kann so aussehen: Man hat Ängste, die man sich nicht erklären kann und für die es eigentlich keinen Anlass gibt. Man ist emotional verunsichert und hat Probleme in Beziehungen oder im sozialen Umfeld. Man hat körperliche Beschwerden, die nicht organisch erklärbar sind. Man fällt in emotionale Tiefen. Das ganze Leben ist – trotz Leistung und Erfolg – nicht zufriedenstellend oder einfach kontinuierlich anstrengend.
Und was jetzt? Die Journalistin Sabine Bode hat sich intensiv mit dem Thema Kriegsenkel beschäftigt. Vielen Betroffenen hilft es, aus Bodes 2013 erschienen Buch Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation oder weiteren Sach- und Belletristikpublikationen erste Erkenntnisse oder wahre „Aha-Erlebnisse“ für das eigene seelische Erfahren und dessen Verarbeitung zu gewinnen. Schon solche Erklärungsmöglichkeiten des bislang Unerklärlichen können heilsame Schritte sein.
Darüber hinaus informiert und vernetzt der 2010 gegründete Verein Kriegsenkel e. V. Verschiedene Veranstaltungen und Gesprächsrunden zum Thema klären auf und helfen im Austausch mit anderen Kriegsenkeln bei der Verarbeitung. Auf der Website des Vereins finden sich zahlreiche Literaturhinweise und Links zu wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema.
Freilich kann das auch die Kriegsurenkel interessieren. Das sind die Kinder der Kriegsenkel, die sich in der dritten Generation von den emotionalen Kriegsfolgen betroffen fühlen.
Traumata zweier Kriege
Außerdem gibt es die Kriegsenkel des ersten Weltkrieges. Das sind ältere Menschen, die alte Eltern hatten, wie in meinem Fall: Meine Eltern waren Kinder des ersten Weltkrieges. Die Mutter wurde im ersten Krieg zur Vollwaise und erlebte als Erwachsene im zweiten Krieg Todesangst und Verlust der gesamten Habe im Bombenangriff. Der Vater erlebte Hungersnot im ersten sowie durch den zweiten Krieg Beinahetod, Gefangenschaft und Vertreibung. Diese beiden kriegsgeprägten Schicksale waren das emotionale Erbe für meine Schwester und mich, wenigstens ohne familiäre Schulderfahrung, weil sie in der Tat Opfer und nicht Täter der NS-Zeit waren.
Ich schließe mich der Aussage vieler Kriegs(ur)enkel an, die sich immer gefragt haben, wieso die Eltern so fremd sind und was das mit einem selbst zu tun haben könnte: Es lohnt, sich diese Verstrickungen und die möglichen Auswirkungen auf das eigene Leben, in dem wir vermeintlich nicht jammern dürfen, bewusst zu machen. Es ist erhellend und erleichtert.
English version:
War grandchildren – insights into an ugly legacy
Will it never end? The current war in Europe brings us closer to horrors we thought we had long since left behind. But was the suffering of the great wars of the last century really so far removed from our families? No, it wasn’t. Because the post-war generations, who grew up in peace and prosperity, are also war grandchildren, i.e. the children of war children. And that explains a lot.
Many people from the baby boomer and Generation X generations have faced problems in their lives that they often consider to be their individual fate: vague fears, psychosomatic disorders, even depression. At the same time, surveys revealed typical responses regarding their parents. Emotional distance, little physical contact, a pronounced aversion to risk, thriftiness, and a focus on performance were behaviors that the younger generation was confronted with.
Millions of these parents had experienced horror, suffering, and trauma as children or teenagers during World War II: deportation abroad, flight from the East, rape by invading soldiers, fear of death during nights of bombing, loss of one or both parents. Some were affected by the suffering of their parents at the front or in camps, others by their parents‘ involvement in National Socialism.
From generation to generation
Those of us who did not experience it ourselves can hardly imagine it. How does a (young) person deal with it? As it turned out, the cruel experiences after the war were suppressed and encapsulated in the psyche. But as we know today, not coming to terms with the past is not healthy and can have fatal consequences. The gerontologist Hartmut Radebold coined the following term for this phenomenon:
transgenerational transmission.
In most cases, the psychological stress caused by the war was passed on to the next generation unconsciously. This can manifest itself in the following ways: People have fears that they cannot explain and for which there is no apparent reason. One feels emotionally insecure and has problems in relationships or in one’s social environment. One has physical complaints that cannot be explained organically. One falls into emotional depths. Despite achievements and success, one’s whole life is unsatisfactory or simply continuously exhausting.
And now what? Journalist Sabine Bode has dealt extensively with the topic of war grandchildren. Many of those affected find it helpful to gain initial insights or have real “aha moments” for their own emotional experiences and how to process them from Bode’s book Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation (War Grandchildren: The Heirs of the Forgotten Generation), published in 2013, or from other non-fiction and fiction publications. Even such explanations of the previously inexplicable can be healing steps.
In addition, the association Kriegsenkel e. V., founded in 2010, provides information and networking opportunities. Various events and discussion groups on the topic provide clarification and help other war grandchildren to come to terms with their experiences through exchange with others. The association’s website contains numerous references to literature and links to academic works on the topic.
Of course, this may also be of interest to the war great-grandchildren. These are the children of the war grandchildren, who are the third generation to be affected by the emotional consequences of war.
Trauma of two wars
There are also the war grandchildren of the First World War. These are older people who had elderly parents, as in my case: my parents were children of the First World War. My mother was orphaned in the First World War and, as an adult, experienced mortal fear and the loss of all her possessions in a bomb attack during the Second World War. My father experienced famine in the first war and near death, imprisonment, and expulsion in the second. These two war-torn fates were the emotional legacy for my sister and me, at least without any family experience of guilt, because they were indeed victims and not perpetrators of the Nazi era.
I agree with the statement made by many war grandchildren and great-grandchildren who have always wondered why their parents are so strange and what that might have to do with them: It is worthwhile to become aware of these entanglements and the possible effects on our own lives, in which we are not supposed to complain. It is enlightening and a relief.


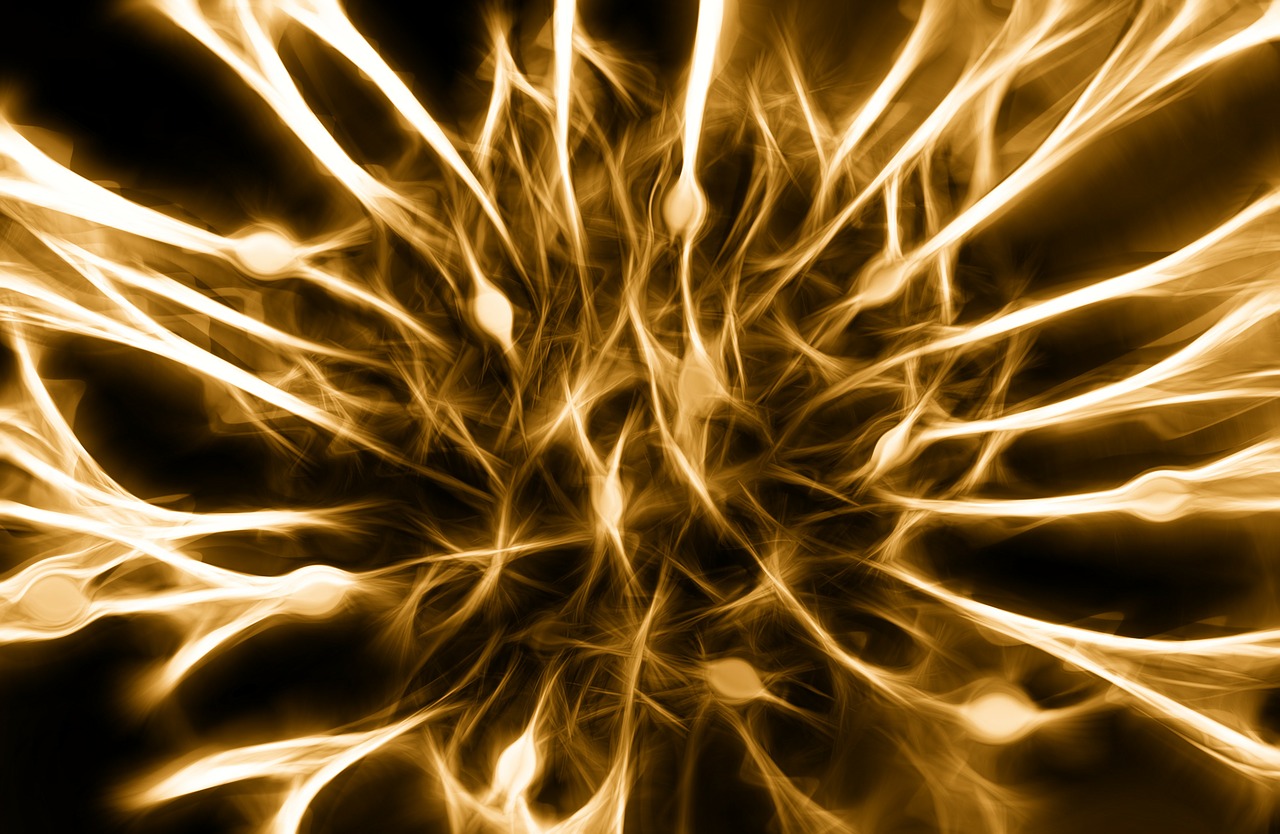


3 Kommentare
Interessanter Aspekt, den Du da beleuchtest. Man sieht das Agieren der eigenen Eltern und Großeltern mit ganz anderen Augen, wenn man versucht, sich in das hineinzuversetzen, was sie erlebt haben. Vieles haben sie vielleicht niemals erzählt.
So ist mir in meiner Familie aufgefallen auf, dass schon die eigenen Kinder (in dem Fall mein Onkel) den ganz faktischen Lebenslauf der eigenen Eltern (mein Großvater) gar nicht so genau kennen und dann natürlich schon gleich nicht nachvollziehen können, was damals alles passiert sein mal.
Du gibst den Anstoß, mal ein bißchen genauer nachzuforschen. Danke, Rita!
Ich freu mich über Dein Interesse! Ich denke, ich selber hatte die Tragweite des Problems immer unterschätzt oder wider besseres Wissen auch ordentlich verdrängt. Aber je besser man diesen Familienschicksalserbekram einordnen kann, desto leichter gelingt es, ein Stück weit seinen Frieden damit zu machen.
Ich bin 5 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg als erstes Kind geboren. Die Zeit war geprägt vom Wiederaufbau und gesellschaftlichen Umbruch. Meine Eltern hatten nicht viel Zeit für uns Kinder, an offen gezeigte Zuneigung kann ich mich nicht erinnern. Meine Mutter war sehr eingespannt mit Haushalt und Kinder erziehen, der Vater mit Geld verdienen (und ausgeben!) beschäftigt. Er war schwer traumatisiert vom Krieg, was jedoch keiner wahrhaben wollte und auch niemand erkannte. Ein Tabuthema halt. Es ging vorrangig darum, welche Familie hat nun den ersten Kühlschrank, die erste Waschmaschine oder ein Auto. Für uns Kinder blieb wenig Zeit. Wir wuchsen halt so nebenher auf. Ich hätte mir schon etwas mehr Verständnis für meine Belange und auch die meiner Schwester gewünscht, aber in Anbetracht der Dinge, die meine Eltern im Krieg erleben mussten, ist das im Nachhinein eher nachvollziehbar. Danke für diesen Artikel, der mich nochmals einen anderen Blick auf diese Zeit werfen lässt.